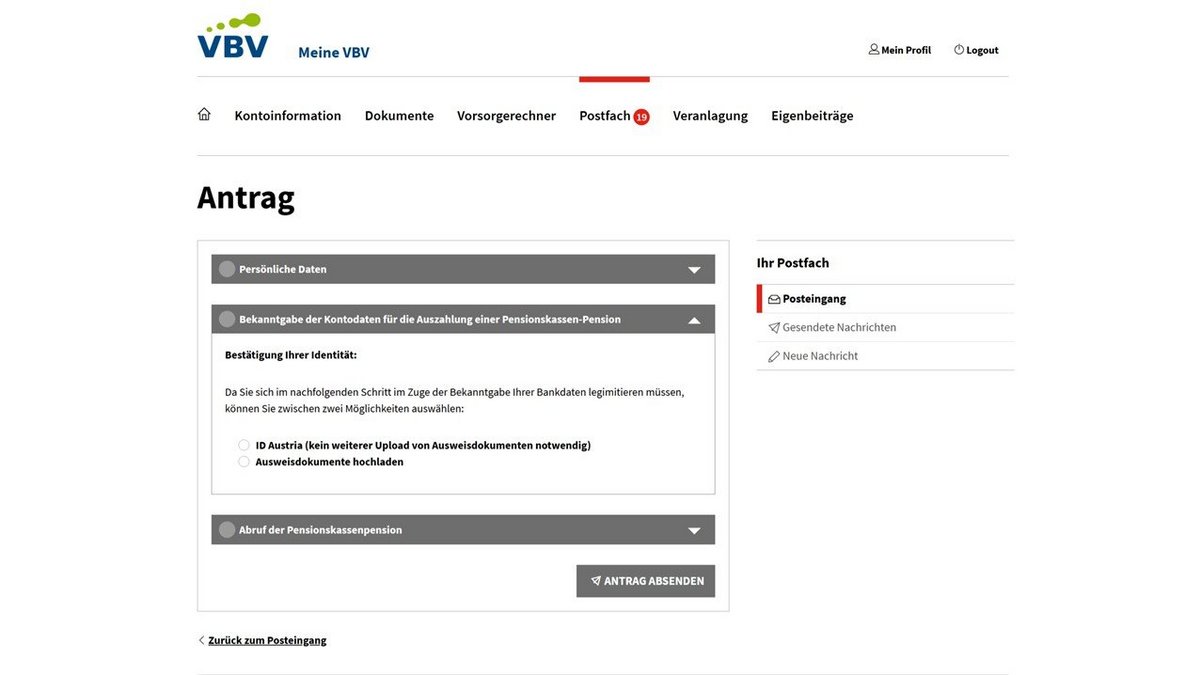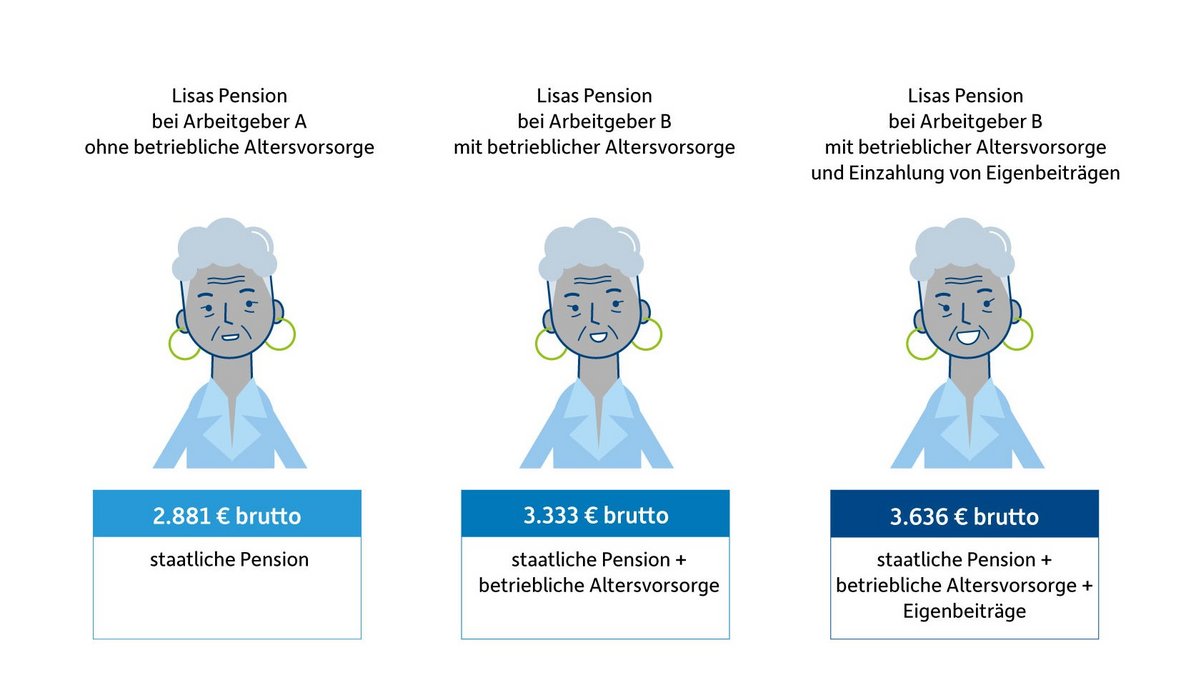Allen voran ist die Taxonomie ein EU-weit einheitliches Klassifizierungsinstrument, mit dem dargestellt wird, ob Projekte, Technologien und Unternehmensaktivitäten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten oder nicht. Sie definiert technische Bewertungskriterien für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, derzeit vor allem in Bezug auf Klima- und Umweltschutzaspekte. Die Taxonomie-Verordnung ist nämlich in zwei Etappen umzusetzen: seit 2022 bezüglich der Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, ab Jänner 2023 dann auch in Hinblick auf die übrigen im Green Deal festgelegten Umweltziele nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Künftig sind solche Ziele und Bewertungskriterien auch noch für den Bereich Soziales geplant. Darüber hinaus verpflichtet die Taxonomie-Verordnung Unternehmen zur Offenlegung der Taxonomie-Konformität ihrer Wirtschaftstätigkeiten. Diese müssen mit mindestens einem der sechs Umweltziele in Einklang sein, ohne dabei ein anderes Umweltziel wesentlich zu beeinträchtigen („do no significant harm“), wenn sie im Sinne der Taxonomie als nachhaltig klassifiziert werden sollen. Ebenso sind dafür Mindeststandards in sozialen Bereichen sowie bei Menschenrechten zu erfüllen.
„Betroffen“ sind davon alle EU-Mitgliedsstaaten, alle Finanzmarktteilnehmenden, die Finanzprodukte anbieten, und Unternehmen, die zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet sind. Die Taxonomie-Verordnung richtet sich aber auch an Unternehmen öffentlichen Interesses mit mehr als 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und große Kapitalgesellschaften.
Die EU-Kommission hat allerdings bereits vorgeschlagen, die Berichtspflichten auszuweiten. Hinzu kommt außerdem, dass die bereits berichtspflichtigen Unternehmen die an sie gestellten Anforderungen oft auch an Zuliefernde weiterleiten. Denn um die eigene Taxonomie-Konformität beurteilen zu können, brauchen sie Daten von diesen. Dazu kommen die Berichtspflichten der Banken, die ihre Kennzahlen nur berechnen können, wenn sie wissen, ob ihre Kredite für Taxonomie-konforme Tätigkeiten genutzt werden. Die Taxonomie wird daher noch weitreichendere Folgen haben, weil auch kleine Unternehmen immer öfter Daten zur eigenen Nachhaltigkeit vorlegen werden müssen.